
Seapeople
Titel
Echtzeitdarstellung von Personenströmen auf See
Laufzeit
Förderprogramm
Sonderaufruf für kleine und mittlere Unternehmen zur Einreichung von Skizzen zur Förderung von datenbasierten Forschungs- und Entwicklungsprojekten entsprechend 8.7.3 f. der Förderrichtlinie „Modernitätsfonds“ des BMVI vom 17.05.2016
Fördergeber
Direkte Verbundpartner
- JAKOTA Cruise Systems GmbH – Koordination
- Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit e.V.
Assoziierte Partner
-
MARSIG GmbH
Gesamtziele des Verbundvorhabens
Im geplanten Verbundprojekt soll ein online-Modul entwickelt werden, welches auf Basis der AIS-Daten von Schiffen und zugehöriger Angaben von Passagierkapazitäten und Besatzungsstärken für ein beliebiges Seegebiet anzeigen kann, wie viele Personen dort gerade oder in einem zu spezifizierenden Zeitraum auf See sind bzw. waren. Je nach Kunde und Anwendungsfeld sollen zusätzliche Informationen verfügbar gemacht werden, z. B. welches Ziel diese Schiffe haben, wann sie in welchem Hafen ankommen sollen bzw. woher diese Schiffe und damit die Personen darauf kommen.
Gesamtziele des Verbundvorhabens
Die Kenntnis von aktuellen Personenströmen auf See ermöglicht Behörden z. B. eine effiziente Konzeption von Sicherheitsmaßnahmen in Gefahrensituationen. Das Verfolgen der seegebietsspezifischen Personenströme über einen längeren Zeitraum kann zudem eine wichtige Informationsgrundlage für die Errichtung von Offshore-Anlagen sein oder auch Basis für umweltrelevante Entscheidungen. Im Zusammenhang mit touristischen Aktivitäten hilft die Nutzung des Systems bei der effektiveren Planung der Logistik.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Bedarfsermittlung
Auf der Basis eines im Projekt erarbeiteten Fragebogens wurden in Interviews die von den verschiedenen potenziellen Nutzern (Touristikverband Mecklenburg-Vorpommern, DGzRS, Rostock Port, …) gewünschten Funktionalitäten und Einsatzszenarien für das zu entwickelnde System erfasst und bewertet. Es zeigte sich, dass die angedachte Personenvorhersage insbesondere für Touristikunternehmen interessant ist. Dabei traten Wünsche nach zusätzlichen Informationen über die zu erwartenden Personenströme auf, z. B. in Bezug auf die oder das Alter von Schiffspassagieren.
Nutzungsszenarien
In den letzten Jahren konnte man über die Medien verfolgen, dass der Unmut über die immer größer werdenden Besucherströme in bestimmten Städten und Regionen auf der Welt zunimmt. Als Beispiel sei die italienische Lagunenstadt Venedig genannt, da diese sehr oft im medialen Fokus stand. Aber auch Städte wie Amsterdam, Palma de Mallorca oder Key West in Florida – USA sehen sich von Kreuzfahrttouristen zunehmend überlaufen und fürchten u. a. Umweltschäden. Zunehmend werden daher durch nationale Behörden Beschränkungen von Touristenzahlen festgelegt. Die derzeit bereits geltenden bzw. in Zukunft zu erwartenden Einschränkungen für die Passagierschifffahrt wurden in einem übersichtlichen Schaubild zusammengestellt.
Das im Projekt entwickelte System kann in Zukunft sowohl Reedereien als auch landbasierten Branchen helfen, diese Regeln rechtzeitig in Routenplanungen zu integrieren. Denkbar ist auch die Etablierung eines Buchungssystems für Regionen mit Personenbeschränkungen.
Rechtliche Prüfung von Urheber-, Verwertungs- und Weitergaberechten der Daten
Laut Anlaufbedingungsverordnung sind Schiffe, die die inneren Gewässer der Bundesrepublik Deutschland anlaufen, dazu verpflichtet, die Gesamtzahl der an Bord befindlichen Personen den zuständigen Behörden zu melden. Die Sammlung aller meldepflichtigen Daten erfolgt über das National Single Window-System, welches im Auftrag der Bundeverkehrsverwaltung z. B. durch die Hafenämter in den jeweiligen Kommunen verwendet wird. Daten an sich sind frei von jeglichen Rechten. Es gibt kein Eigentum an Daten, weder an Forschungsdaten, personenbezogenen Daten oder Geodaten. Die erhobenen Daten an sich, im Verbundprojekt z. B. die Erfassung von Personenzahlen, stellen entsprechend kein urheberrechtlich geschütztes Werk dar. Erst, wenn die erfassten Daten in eine Datenbank integriert, visualisiert, aufbereitet und / oder ausgewertet werden, entsteht aus den Daten ein urheberrechtlich schützenswertes Werk. Diese Tatsache gilt universell für jede Art von Daten, unabhängig vom Aufwand, den die Datenerzeugung möglicherweise erfordert hat, oder vom beabsichtigten Nutzungszweck. Versteht man unter „Daten“ allerdings Inhalte, die zum Beispiel Bilder oder Texte enthalten, die über reine Informationen hinausgehen, können Schutzrechte bestehen. Für die erfassten Personenzahlen ist dies nicht zutreffend, da es sich dabei um eine reine Mengenangabe handelt, die durch einfaches Zählen ermittelt werden kann.
Trotz ihrer allgemeinen urheberrechtlichen Schutzlosigkeit kann die Nutzung von Daten Restriktionen unterliegen. Das gilt einerseits für personenbezogene Daten, deren Erfassung und Verarbeitung die Datenschutzverordnung regelt. Zudem können Daten Geschäftsgeheimnisse enthalten, für deren Verwendung ebenfalls rechtliche Beschränkungen gelten können. Im Falle der projektrelevanten Daten müsste daher von Seiten der Reedereien nachgewiesen werden, welche Daten ggf. als Geschäftsgeheimnisse einzustufen sind, so dass eine Nutzung an bestimmte Regeln gebunden werden kann. Um Datenschutzrechte nicht zu verletzen, basieren die im Projekt verwendeten Daten ausschließlich auf nicht personenbezogenen Daten. Anonymisierte Daten gelten nicht als personenbezogene Daten! Auch die anonymisierte Erfassung und Verarbeitung von Angaben zu Geschlecht oder Alter ist somit möglich, solange die erhobenen Daten keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zulassen.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Algorithmen zur Quantifizierung von Personenzahlen
Da die Personenzahl nur selten mit den AIS-Daten übermittelt wird, ergab sich die Fragestellung, ob es möglich ist, eine Korrelation von Schiffsgröße mit den Passagierzahlen herzustellen. Kann man also aus der Größe eines Kreuzfahrtschiffes auf eine Personenzahl an Bord schließen? Für die Analyse wurden zunächst alle derzeit bekannten Kreuzfahrtschiffe mit ihren ausgewiesenen Besatzungs- und Passagierzahlen erfasst und diese Personenzahlen zu den Schiffsmaßen in Bezug gesetzt. Um den Zusammenhang darzustellen, wurde ein Schaubild erstellt. Für die quantitative Betrachtung erfolgte eine Zusammenfassung von Schiffslängen in 50-Meter Schritten und eine Zuordnung der durchschnittlichen Passagierzahlen für die Schiffslängen in dem jeweiligen Bereich. Man erkennt eine deutliche Abhängigkeit, die jedoch nicht linear ist. Zudem fällt auf, dass mit zunehmender Schiffsgröße immer weniger Crew für immer mehr Passagiere verantwortlich ist. Die gefundene Kurve kann in das zu erstellende System integriert und zur Ableitung unbekannter Personenzahlen genutzt werden, wenn keine anderen Datenquellen dafür vorliegen.
Auch für Handelsschiffe wurden mögliche Besatzungsstärken ermittelt. Die Anzahl des an Bord tätigen Personals richtet sich hierbei weniger nach der Größe des Schiffes, sondern nach dem Typ (z. B. Frachtschiff, Containerschiff, Tankschiff) und den entsprechend an Bord durchzuführenden Arbeiten. Dennoch ist der zahlenmäßige Rahmen für alle Handelsschiffe eng. Er bewegt sich etwa zwischen minimal 12 und maximal 25 Personen. Es wurde zudem eine Abhängigkeit zwischen dem Alter des Schiffes und der Besatzungsstärke festgestellt: Je älter ein Schiff ist, umso mehr technische Besatzung wird benötigt, um alle Systeme zu bedienen und zu warten.
Kompliziert ist die Ableitung von Personenzahlen für Fährschiffe. Anders als bei Kreuzfahrtschiffen, die in der Regel weitgehend ausgebucht fahren, ist die tatsächliche Personenzahl an Bord sehr schwankend und kann nicht in etwa gleich der möglichen Kapazität gesetzt werden.
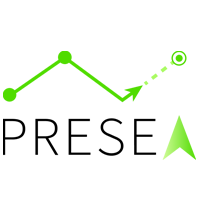
Presea
Titel
Echtzeitbasierte Seeverkehrsvorhersage
Laufzeit
2019–2022
Förderprogramm
„Echtzeittechnologien für die Maritime Sicherheit“
Fördergeber
BMWI
Direkte Verbundpartner
- JAKOTA Cruise Systems GmbH | FleetMon – Koordination
- Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit e.V.
Assoziierte Partner
-
Reederei F. Laeisz GmbH
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Ziel des Projektes ist die softwaretechnische Umsetzung und grafische Darstellung einer echtzeitbasierten Vorhersage des Seeverkehrs für bis zu 14 Tage im Voraus mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 90–70 % (abnehmend mit immer weiter in die Zukunft reichenden Anfragen). Auf einer allgemein zugänglichen (ggf. gebührenpflichtigen) online-Plattform soll über eine benutzerfreundliche Oberfläche der zu erwartende Schiffsverkehr zu einem bestimmten Zeitraum innerhalb der kommenden Tage und in einem wählbaren Seegebiet abgefragt werden können. Über einen Filter soll auch die Eingrenzung für bestimmte Schiffstypen, wie z. B. Tankschiffe oder Kreuzfahrtschiffe möglich sein.
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Die Darstellung basiert auf der Verknüpfung von aus den AIS-Daten der Schiffe lesbaren Informationen, den Fahrplänen von Feeder-, Linienverkehr-, Fähr- und Kreuzfahrtschiffen und äußeren Einflüssen, wie z. B. Gezeiten durch einen „Big-Data“- Auswertealgorithmus. Varianten zur Individualisierung von Nutzungsrechten für verschiedene Zielgruppen sollen vorgesehen werden. Die Darstellung der Seeverkehrsvorhersage soll sowohl auf PC als auch auf mobilen Endgeräten möglich sein und eine neue Dienstleistung für die maritime Branche bereitstellen und somit innovative Geschäftsmodelle ermöglichen.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Bedarfsermittlung und Nutzeranalyse
Auf der Basis eines im Projekt erarbeiteten Fragebogens wurden in Interviews die von den verschiedenen potenziellen Nutzern (Reedereien, Behörden, Logistikunternehmen, Versicherungen, …) gewünschten Funktionalitäten und Einsatzszenarien für das zu entwickelnde System erfasst und bewertet. Es ergaben sich wichtige Anwendungsszenarien. Zum Beispiel könnte es im Zuge des geplanten Baus und Betriebs von LNG-Bunkerstationen in einem Hafen wichtig sein zu wissen, wann in den kommenden Tagen besonders viele Schiffe mit Gefahrgut an Bord zu erwarten sind, da Gefahrgutverladungen und LNG-Bunkervorgänge möglicherweise nicht zeitlich parallel durchgeführt werden können. Das Vorhersagesystem würde hier eine effektive Planung deutlich unterstützen.
Aufbereitung von Verkehrs- und Logistikdaten
Um bestimmte Muster in den Verkehr- und Logistikdaten zu erkennen, wurden Untersuchungen zu typischen Strukturen im Seeverkehr vorgenommen, u.a. wurden alle Routen im RORO-Verkehr in Nord-& Ostsee sowie im Mittelmeerraum ermittelt. Dabei wurden 939 Fährrouten mit den zugehörigen LOCODES der durch die Fährlinie verbunden Häfen registriert. Eine Zuordnung von möglichen Zielhäfen wird durch die Kenntnis dieser Routen erleichtert.
Der weltweite Containerverkehr findet zu einem großen Teil nach stringenten Fahrplänen auf definierten Linien statt. Im Projekt wurden über 4.100 Containerlinien identifiziert, die von ca. 116 Reedereien bedient werden. Die ermittelten Container-Routen wurden dem Projektpartner JCS zur Verfügung gestellt. Umgekehrt erfolgte ein Abgleich ausgewählter Routen mit den durch Jakota Cruise Systems zur Verfügung gestellten LINESCAPE-Daten von Containerschiffen. Es zeigte sich, dass die Routen in diesen Daten ebenfalls identifiziert werden konnten, es jedoch häufig zu Abweichungen kommt, z. B. durch Wartezeiten vor Häfen oder schwierige Wetterbedingungen. Die entstehenden Verzögerungen können mehrere Tage betragen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass eine echtzeitbasierte Seeverkehrsvorhersage von Container-Schiffen auf reiner Fahrplan-Basis zwar eine Grundlage sein kann, aber zu ungenau wird. Die Integration von tatsächlichen Routendaten ist notwendig.
Algorithmen zur Next-Port-Zielbestimmung
Das im Projekt entwickelte System zur Seeverkehrsvorhersage beruht wesentlich auf der Auswertung des im AIS angegebenen nächsten angelaufenen Zielhafen („next port“). Dieser wird in einem definierten Format in Form eines LOCODE durch die Crew angegeben. Der Aufbau und die Struktur der LOCODES wurden im Projekt ausführlich analysiert sowie in einem Schaubild dargestellt. UN/LOCODEs bestehen typischerweise aus fünf Buchstaben. Die ersten beiden Buchstaben sind der Ländercode, gefolgt von drei Buchstaben für die konkrete Ortsangabe, z. B. DE RSK steht für den Hafen Rostock in Deutschland. Bei der Eingabe an Bord geschehen häufig Fehler, was die Ermittlung des tatsächlich gemeinten Zielhafens verhindert und damit eine Seeverkehrsvorhersage erschwert. Eine Hauptaufgabe des Teilprojektes bestand daher in der Schaffung sinnvoller Algorithmen zur Zuordnung von falsch geschriebenen Codes zu den tatsächlich gemeinten. Als Grundlage für diese Arbeit wurde dem ISV durch den Projektpartner Jakota Cruise Systems eine Datei mit über 60.000 nicht zuordenbaren Zieleingaben zur Verfügung gestellt. In dieser Ursprungsdatei wurde zunächst eine Häufigkeitsanalyse vorgenommen, um die auszuwertenden Daten einzugrenzen. Für die weitere Bearbeitung wurden nur die nicht zuordenbaren Zieleingaben berücksichtigt, welche fünf Mal oder öfter vorkamen. Bei den verbleibenden ca. 15.000 erfolgte als nächster Schritt eine Abtrennung von „Zieleingaben“ die gar keine Häfen beschreiben, sondern auf bestimmte Situationen an Bord hinweisen, wie z. B. „armed guards onboard“, diese wurden in eine separate Datenbank aufgenommen.
Die auszuwertenden Datensätze konnten so auf ca. 7500 reduziert werden, die sich auf ca. 730 verschiedene Falschschreibungen verteilten. Diese wurden u.a. anhand historischer Routen-Daten der Schiffe, die diese falschen Angaben ins AIS eingegeben hatten, den tatsächlich gemeinten Häfen zugeordnet.
Ein weiterer wichtiger Ansatz für diese Arbeit war die Zuordnung von Subhäfen zu den übergeordneten Häfen. Oft hat nur das gesamte Hafengebiet einen einzigen LOCODE, in der Zieleingabe wird aber von der Crew ein Subhafen (z. B. Ölhafen) oder einzelner Liegeplatz angegeben, so dass eine derzeit nicht identifizierbare Zieleingabe entsteht. Um hier einen besseren Überblick zu erhalten, wurden für Rostock und Hamburg Karten mit Zuordnung der einzelnen Unterhäfen angefertigt.
Die entstandene „Übersetzungstabelle“ wurde dem Projektpartner JCS zur Integration in den selbstlernenden Algorithmus zur Verfügung gestellt.
Auch wenn es im AIS gewünscht ist, den nächsten Hafen mittels seines LOCODEs anzugeben, kommt es häufiger vor, dass Schiffsbesatzungen den Klarnamen des Hafens als nächstes Ziel eingeben. Da es weltweit verschiedenste Häfen mit dem gleichen Namen gibt, wie z. B. Vancouver, Sydney oder rund 80 andere, kann es zu Verwechselungen kommen. Es wurde eine Auflistung von gleichnamigen Häfen erstellt und die jeweilige Lage und die Besonderheiten der Häfen überprüft, z. B. ob es sich um einen Seehafen, eine Marina oder einen Binnenhafen handelt. Mit Hilfe von Ausschlusskriterien kann eine Zuordnung des tatsächlich gemeinten Hafens deutlich verbessert werden, da z. B. nicht zu erwarten ist, dass ein großer Rohöltanker in einen Hafen ohne Ölterminal einlaufen wird.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Routing mit automatisierter Berücksichtigung statischer und dynamischer schiffsspezifischer Einflüsse
In diesem Arbeitspaket wurde zunächst ermittelt, welche Einflüsse sich auf das Routing von Schiffen auswirken. Dazu erfolgte eine Unterteilung in folgende Kategorien:
- Schiffsspezifische Einflüsse (Schiffskonstruktion)
- Schiffsspezifische Einflüsse (Ladung)
- Umwelteinflüsse/Wetter
- Geografische Einflüsse
- Urbane Infrastrukturen
- Rechtliche Vorgaben
- Politische/militärische Einflüsse
- Weiteres
Die den einzelnen Kategorien zugeordneten Unterpunkte wurde in statische und dynamische Faktoren eingeteilt und ihr Einfluss auf das Routing und die damit verbundene Reisezeit bewertet.
Statische und dynamische Einflussfaktoren wirken sich auf verschiedene Schiffe unterschiedlich aus. Ein großes Containerschiff wird bestimmte Wellenhöhen und Windstärken noch bewältigen können, ein Kreuzfahrtschiff würde gleiche Wetterbedingungen zum Wohl der Passagiere vermutlich meiden und eine andere Route nehmen oder einen Tag in einem Hafen abwettern. Aber auch Antriebsart oder die konkret transportierte Ladung können Einfluss auf die zu wählende Schiffsroute haben. Dementsprechend muss der Schiffstyp u.a. bei der Seeverkehrsvorhersage berücksichtigt werden. Im Teilprojekt wurde daher eine detaillierte Gliederung für Schiffstypen erarbeitet. Nachfolgend wurde analysiert, inwieweit Wettereinflüsse für die verschiedenen Schiffstypen Einfluss auf deren Routen haben. Dazu wurden vorhandene historische Wetter-Datensätze mit historischen Routendaten von Schiffen kombiniert und ausgewertet in Bezug auf die Fragestellung, ob es für verschiedene Schiffstypen limitierende Wetterverhältnisse gibt. Dabei war das Ziel, Vorhersagealgorithmen zu entwickeln, welches Schiff oder welche Schiffsgruppe bis zu welchen Wetterkennwerten von Windstärke und Wellenhöhe eine Route noch befahren wird. Die Auswertung ergab erste nutzbare Eingrenzungen, die jedoch mit weiteren Daten untermauert werden müssen. Die sich ergebende Fragestellung hierbei war, ob die historische Routenführung, also z.B. die Umfahrung eines Sturmes tatsächlich eine bewusste Entscheidung des Kapitäns war, weil er wusste, dass sein Schiffstyp ungeeignet für dieses Wetter ist oder er einfach aufgrund von üblichen Verzögerungen im Hafen später losgefahren ist und somit den Sturm eher zufällig vermieden hat.
Nach der Erfassung aller Parameter bestand die folgende Aufgabe darin, ihre Auswirkungen qualitativ zu bewerten, um daraus Rückschlüsse auf die mögliche Beeinflussung der Gesamt-Fahrtzeit und damit der ETA (Estimated Time of Arrival) zu ziehen. Diese wird dabei im Wesentlichen durch die Schiffsgeschwindigkeit, die Fahrtroute, geografische Besonderheiten und die Hafenliegezeiten beeinflusst. Dabei zeigte sich, dass die Geschwindigkeit insbesondere durch Wetterereignisse, die Fahrtroute insbesondere durch konstruktive Merkmale des Schiffes und die Hafenliegezeiten vor allem durch die Art und Menge der Ladung an Bord beeinflusst wird. Das Verkehrsaufkommen wirkt sich auf alle drei Aspekte stark aus. In der zu entwickelnden Software wären die verschiedenen Parameter also entsprechend zu wichten.
Bestimmung der Verkehrsmenge
Die mithilfe der Seeverkehrsvorhersage ermittelten Daten sollen möglichst anschaulich dargestellt werden. Hierfür wurden verschiedene Varianten. Möglich sind z. B. Heatmaps, wo die Verkehrsdichten mit verschiedenen Farben dargestellt werden oder gebietsbezogene Anklickpunte, die nach Anklicken in einem Pop-Up-Fenster die Schiffsanzahl in dem jeweiligen Gebiet anzeigen. Auch Vorschläge für die grafische Darstellung der zeitlichen Vorauswahl wurden erarbeitet.
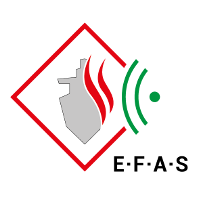
EFAS
Titel
Einsatzunterstützungssystem für Feuerwehren zur Gefahrenbekämpfung an Bord von Seeschiffen
Laufzeit
2016–2019
Förderprogramm
„Zivile Sicherheit – Innovative Rettungs- und Sicherheitssysteme“ im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit 2012–2017“ der Bundesregierung
Fördergeber
BMBF
Direkte Verbundpartner
- Fraunhofer FKIE – Koordination
- Institut für Sicherheitstechnik/ Schiffssicherheit e.V.
- Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF)
- Ingenieurgesellschaft für Maritime Sicherheitstechnik und Management mbH Warnemünde
- Hubert Schmitz GmbH
- ATS Elektronik GmbH
Assoziierte Partner
- Feuerwehr Wilhelmshaven
- Verband Deutscher Reeder
- Hafen Rostock
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Übergeordnetes Ziel des Vorhabens ist die Erhöhung der Sicherheit von Feuerwehrkräften bei der Gefahrenbekämpfung an Bord von in Häfen liegenden Seeschiffen. Anders als bei Havarien auf See werden bei Havarien von in Häfen liegenden Schiffen die landseitigen Feuerwehren eingesetzt. Diese besitzen jedoch nur eine notdürftige nautische Ausbildung. Grundsätzlich ist eine Übertragung von landseitigen Maßnahmen und Systemen auf die schiffsseitige Gefahrenbekämpfung kaum möglich. Gründe hierfür sind unterschiedlichste räumliche Gegebenheiten bei verschiedenen Schiffsklassen sowie die Diversität von Ladungsgütern. Hinzu kommen situationsabhängige Gegebenheiten wie die Manövrierfähigkeit und Stabilität des Schiffes (z. B. bei Eintritt von Löschwasser), die stählerne Umgebung, die besondere Eigenschaften bspw. in Bezug auf die Hitzeentwicklung bewirkt, und die Tatsache, dass sich Einsatzkräfte bei einer Gefahrenbekämpfung im Schiffsbauch, anders als bei einem Häuserbrand, ihren Weg zum Brandherd der Rauchentwicklung entgegengesetzt bahnen müssen. Hierdurch entsteht ein erhöhtes Risiko für die Einsatzkräfte. Um Schäden und Beeinträchtigungen zu vermeiden, soll im Projekt die Sicherheit, Effizienz und Effektivität der Einsatzkräfte mit technologischen Neuentwicklungen erhöht werden. Dafür wird ein innovatives technologisches Gesamtkonzept entwickelt, das aus Einzelkomponenten zusammengesetzt ist. Für die Vor-Ort-Einsatzleitung der Feuerwehr wird ein sich ständig aktualisierendes Lagedarstellungssystem konzipiert, das der Einsatzleitung der Feuerwehr zur Verfügung steht. Dieses wird zum einen in Abhängigkeit des Schiffstyps aus einer zu entwickelnden Datenbank mit grundlegenden Informationen wie an Bord vorhandene Brandbekämpfungsanlagen und Sicherheitssysteme sowie dem Brandbekämpfungsplan des jeweiligen Schiffes, technischen Schiffsdaten und Zugangsmöglichkeiten gespeist. Zum anderen verarbeitet es schiffsspezifische Ladungs- und Gefahrgutdaten sowie Passagierlisten.
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Die Grundlage der Lagedarstellung sollen dabei digitalisierte Deckspläne bilden. Das Lagedarstellungssystem erhält zudem eine Komponente zur Entscheidungsunterstützung, welche sinnvolle Angriffstaktiken unter Berücksichtigung des Gefahrenortes (z. B. Aufbauten, Maschinenraum, Ladung) und der zu erwartenden Situationsentwicklung vorschlägt.
Es soll ein System zur Ortung von Feuerwehrleuten im Einsatz an Bord entwickelt werden. Zudem soll über die Weiterentwicklung intelligenter Kleidung bspw. zur Erfassung der Umgebungstemperatur, Sauerstoffvorrat und weiterer Parameter der Zustand von Einsatzkräften erfasst werden. Die Lokalisierung der Einsatzkräfte und die Erfassung ihres Zustands über Echtzeitüberwachung stellen einen wichtigen Input für das Entscheidungsunterstützungssystem dar und helfen, Situationen richtig einzuschätzen und Rettungskräfte in Abhängigkeit der Gefahrenentwicklung zu schützen und zu leiten. Zur notwendigen breitbandigen Kommunikation ist eine robuste Datenverbindung aus dem Schiff heraus notwendig. Hierzu werden LTE-Systeme erforscht. Ein ganzheitlich optimiertes Kommunikationskonzept soll darüber hinaus den effizienten Austausch der Vor-Ort-Einsatzleitung, den Trupps an Bord des Schiffs, der Besatzung des Schiffs sowie dem Lagezentrum verbessern.
Darüber hinaus werden projektbegleitend die Akzeptanz der entwickelten Unterstützungssysteme untersucht, technische Lösungen in Standards überführt und vorausschauend zukünftige Entwicklungen wie Veränderungen bei den zum Einsatz kommenden Kraftstoffen (z. B. LNG; Methanol, Wasserstoff) abgeschätzt.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Analyse von Schiffshavarien, Szenarien
Um die Art der benötigten Informationen einzugrenzen, wurde zunächst eine Analyse der Schiffsunfälle in Hafengebieten durchgeführt. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von 2000–2016. Für die Aufstellung wurden Berichte in den Medien sowie Untersuchungsberichte der zuständigen Behörden in Deutschland (BSU) bzw. anderer Staaten ausgewertet. Es erfolgte eine Gliederung nach der Art der Havarie (Brand, Gewässerverschmutzung, Gefahrstoffaustritt, Arbeitsunfall, Wassereinbruch) und eine Zuordnung relevanter Aspekte (Schiffstyp, Ladungsart, Alarmkette, Ursache der Havarie, Maßnahmen, Probleme während des Einsatzes, Schäden). Insgesamt wurden 390 Unfälle erfasst, von denen die meisten Vorfälle solche waren, bei denen es zu einer Gewässerverschmutzung kam. Bei diesen Vorfällen ist das Eingreifen der Feuerwehren in der Regel nicht mit einem Einsatz an Bord verbunden, daher wurden sie in EFAS nicht näher untersucht. Es wurde 45 Vorfälle detaillierter ausgewertet, die von besonderer Relevanz erschienen. Auf Basis der Unfallanalyse wurden die Szenarien „Brand“ und „Gefahrstoffaustritt“ als einerseits besonders häufige und andererseits als besonders relevante Szenarien ermittelt.
Analyse von Ausbildungsinhalten
Es wurde eine Umfrage durchgeführt, welche Themen aus Sicht der Feuerwehren in Zukunft mehr geschult und trainiert werden sollten. Für die Abfrage wurde ein umfangreicher Fragebogen entwickelt. Daraus ergab sich, dass besonders Fragen im Zusammenhang mit Wassereinbruch, der Evakuierung von Personen sowie dem Einsatz alternativer Kraftstoffe häufiger und intensiver in Weiterbildungsangeboten vermittelt werden sollte. Auch das Lesen und Bewerten von Schiffsplänen für eine schnelle Lagererstellung und Maßnahmenplanung wurde als notwendiger Weiterbildungs-bedarf bewertet, ähnlich wie Fragen im Zusammenhang mit der Kommunikation zwischen allen Beteiligten und dem maritimen Englisch.
Entwicklung von Lehrmaterialien
Innerhalb des Projektes wurde das „Handbuch für Feuerwehren – Notfallbewältigung auf Seeschiffen“ erstellt – ein Kompendium für Feuerwehren über die spezifischen Bedingungen an Bord und die Besonderheiten der Sicherheitssysteme auf verschiedenen Schiffstypen. Das Buch wurde dem Havariekommando vorgestellt und dort als sehr gutes Lehrmaterial bewertet.
Weiterhin wurde ein Decksmodell zur anschaulichen Darstellung von Schiffsplänen sowie zur Nutzung bei der Lagebilderstellung angefertigt. Eine Havarie kann so schnell veranschaulicht werden und anhand des Modells können z. B. mögliche Angriffsrouten für die Einsatzkräfte diskutiert werden. Zugleich kann das Decksmodell auch für Planspiele eingesetzt werden. Für die Nutzung in Weiterbildungskursen wurde ein LNG-Bunker-Simulations-Modell zur praktischen Übung der Handlungsabläufe vor, während und nach dem Bunkern von Liquefied Natural Gas gebaut.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Handlungsempfehlungen
Für die Integration in das Entscheidungsunterstützungssystem (EUS) wurden für die festgelegten Szenarien konkrete Handlungsempfehlungen für Einsatzkräfte erarbeitet. Dafür wurden zunächst Baumstrukturen angelegt z. B. für den Fall „Brand“, entlang denen eine Menüführung möglich wäre und die einen Nutzer schrittweise zu den von ihm gesuchten Informationen leitet (z. B. Brand Brand auf Tankschiff Brand auf Öltankschiff Brand im Maschinenraum Löschanlagen im Maschinenraum). Beim Anklicken der einzelnen Felder könnten dann im EUS die jeweils hinterlegten Informationen erscheinen.
Leistungsgrenzbereiche des menschlichen Körpers
Das Institut führte umfangreiche Untersuchungen zu Grenzwerten verschiedener physikalisch/chemischer Größen hinsichtlich der maximalen Belastbarkeit des menschlichen Körpers durch. Dies sollte genutzt werden, um für die in die Schutzbekleidung integrierte Sensorik sinnvolle Alarmschwellen festzulegen. Untersucht wurde u. a. die Belastbarkeit des Körpers gegenüber Temperaturen und Druck sowie chemischen Substanzen, die in Brandgasen zu erwarten sind.
Feldtest und Übungen
Während der Projektlaufzeit wurden gemeinsam mit den anderen direkten bzw. assoziierten Partnern verschiedene kleinere Feldtest für Funktionsprüfungen vorbereitet. Diese fanden im Brandcontainer in Wilhelmshaven statt.
Zudem wurde eine umfangreiche Abschluss-Evaluations-Übung auf dem Traditionsschiff in Rostock-Schmarl organisiert, bei der es um das Testen des Zusammenspiels aller, von den einzelnen Partnern entwickelten, Teiltechnologien ging. Dabei konnte die Feuerwehr Rostock als testender Anwender gewonnen werden. Die Übung wurde erfolgreich am 23.09.2019 durchgeführt.
Alle Projektergebnisse werden ausführlich im Abschlussbericht beschrieben.

Skillful
Titel
Skills and competences development of future transportation professionals at all levels
Laufzeit
2016–2019
Webseite
Förderprogramm
European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme
Direkte Verbundpartner
- Forum des Laboratories Nationaux Europeens de recherche Routiere – Koordination
- University of Newcastle upon Tyne
- Fundacion de la Comunidad Valenciana para la Investigacion, Promocion y Estudios Comerciales de Valencia Port
- Universita degli Studi di Firenze
- Zilinska Univerzita v Ziline
- Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis
- Deep Blue SRL
- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
- Tyoethehoseura RY
- European Conference of Transport Research Institutes
- Institut für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.
direkte Verbundpartner
- Foundation Wegement – a European Association of Universities in Marine Technology and related Sciences
- Union Internationale des Chemins de Fer
- Belgisch Instituut voor de Verkeersveikligheid VZW Institut Belge pour la Securite Routiere ASBL
- Technische Universität Berlin
- EURNEX e. V.
- Universitat de Valencia
- Politecnico di Torino
- University College Dublin, National University of Ireland
- MOV’EO
- Instituto Superior Tecnico INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO – BENEFICIARY
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Der Transportsektor beschäftigt über 10 Millionen Menschen in der EU. Gleichzeitig ist der Verkehr ein sozialer Sektor, der sich schnell entwickelt und in höchstem Maße von der Automatisierung, Elektrifizierung und Ökologisierung beeinflusst wird und daher vor Problemen steht, seine verschiedenen Bereiche mit angemessenem und qualifiziertem Personal zu besetzen. Diese Tatsache macht Änderungen der Schulungs- und Ausbildungsinhalte, Lehrpläne, Werkzeuge und Methoden absolut zwingend erforderlich, wobei Aspekte des lebenslangen Lernens für die Fachleute in allen Verkehrsbereichen einbezogen werden müssen. Die Vision von SKILLFUL besteht darin, die Fähigkeiten und Kompetenzen zu identifizieren, die von den Transportarbeitern der Zukunft benötigt werden, und die Trainingsmethoden und -instrumente zu definieren, um sie zu erfüllen. Für die genannten Trends wird die Beschäftigungsfähigkeit durch SKILLFUL eng mit den zukünftigen Anforderungen an Transportberufe für alle Transportmodi und multimodalen Ketten und für alle Ebenen/Arten von Arbeitnehmern verbunden, während alle Ausbildungsmodi einbezogen und ausgewogen integriert werden.
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Um dies zu erreichen, zielt SKILLFUL darauf ab, die bestehenden, neu entstehenden und zukünftigen Wissens- und Qualifikationsanforderungen von Arbeitnehmern auf allen Ebenen im Transportsektor zu überprüfen und die wichtigsten Spezifikationen und Komponenten der Lehrpläne und Schulungskurse zu strukturieren, die erforderlich sind, um diese Kompetenzanforderungen zu erfüllen bzw. zu optimieren. Es sollen neue Ansätze in der Bildungs- und Ausbildungskette identifiziert werden, um eine europaweite Kompetenzentwicklung zu erreichen. Die Projektergebnisse werden durch eine große Anzahl von Pilotkursen mit gering bis hochqualifizierten Arbeitskräften aus allen Verkehrsträgern europaweit verifiziert.
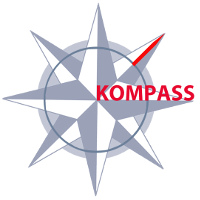
Kompass
Titel
Kompetenz und Organisation für den Massenanfall von Patienten in der Seeschifffahrt
Webseite
Laufzeit
2014–2017
Förderprogramm
Forschung für die Zivile Sicherheit
Fördergeber
BMBF
Direkte Verbundpartner
- Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Koordination)
- mainis IT-Service GmbH
- GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH (GS), corpuls
- Albert-Ludwig-Universität, Institut für Soziologie (ALU)
- BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH (ukb)
- Universitätsmedizin Greifswald, Abt. für Unfall- und Wiederherstellungs-chirurgie (UMG)
Assoziierte Partner
- AIDA Cruises
- Bugsier-, Reederei- und Bergungs-Gesellschaft mbH & Co. KG
- Hafen- & Seemannsamt Rostock
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Großschadenslagen im maritimen Umfeld können jederzeit eintreten und eine große Zahl von Personen betreffen. Während es für komplexe Schadenslagen an Land inzwischen erprobte Einsatzkonzepte gibt, ist dies für den See- und Hafenbereich nicht der Fall.
Ein Massenanfall von Patienten auf See birgt im Vergleich zum Land zahlreiche besondere Umstände, wie z. B. erschwerter Zugang für Rettungskräfte, Distanz, eingeschränkte Platzverhältnisse, begrenzte Transportmittel, insbesondere bei schweren Wetterbedingungen.
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Die Bewältigung eines solchen Notfalls erfordert die effektive Zusammenarbeit verschiedener Akteure: Rettungsmannschaften, nationale und internationale Behörden, Reedereien und Hafenbetreibergesellschaften müssen mit der Schiffsbesatzung kommunizieren und gemeinsam Entscheidungen zur bestmöglichen Versorgung der Betroffenen treffen.
Das Ziel von KOMPASS ist die Konzeption, Erarbeitung und Umsetzung eines integrativen Managementsystems zur Patientenversorgung auf See, das sich aus strukturellen, organisatorischen und technischen Maßnahmen zusammensetzt.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Innerhalb des Teilprojektes im Verbundprojekt KOMPASS hat das Institut für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V. verschiedene Lösungsansätze für die Effektivierung der Bewältigung eines MANV auf See entwickelt und getestet, u.a. hinsichtlich
- die Integration des Themas MANV auf See in die medizinischen Wiederholungslehrgänge für Schiffsoffiziere
- die Integration von Offshore-Anlagen in ein Evakuierungskonzept
- die Erstellung und das Training von MANV-Konzepten auf Passagierschiffen
- die Erweiterung der medizinischen Ausrüstung an Bord speziell für den MANV
Die erarbeiteten Konzepte und Ergebnisse stellen grundlegende Ansätze dar, die für die konkreten Schiffe oder Behörden angepasst werden können. Als ein wichtiges Projektergebnis ist die generelle Sensibilisierung der Beteiligten für das Thema zu nennen.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Während Havarien wie Brand oder Wassereinbruch auf Schiffen aus der Seefahrtstradition heraus bekannte und untersuchte Vorfälle sind, ist ein MANV auf See ein relativ neues Szenario, welches vor allem durch die starke Zunahme der Passagierschifffahrt in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat.
Während der Projektbearbeitung ergab sich auch die Erkenntnis, dass für die Zukunft verbesserte oder überhaupt erst politische Lösungen geschaffen werden müssen, um einen MANV auf See effektiver vorbeugen bzw. bewältigen zu können. Besonders der Föderalismus in Deutschland erschien an vielen Stellen als Hürde für eine einheitliche technische und organisatorische Abarbeitung eines MANV auf See. Parallel wirft die immer weiter zunehmende Größe und Anzahl von Personen auf Kreuzfahrtschiffen Fragen auf. Gesetzliche Begrenzungen scheinen hier sinnvoll.
Die hochkomplexe Thematik ist mit dem Ende des Projektes nicht abgeschlossen und muss auch in Zukunft intensiv beforscht werden.

Sireva
Titel
Sicherheit von Personen bei Rettungs- und Evakuierungsprozessen von Passagierschiffen
Laufzeit
2013–2016
Förderprogramm
Forschung für die Zivile Sicherheit
Fördergeber
BMBF
Direkte Verbundpartner
- Fraunhofer FKIE – Koordination
- ATS Elektronik GmbH
- Hochschule Wismar, Bereich Seefahrt
- IAW, RWTH Aachen
- INTERSCHALT Maritime Systems AG
- ISV – Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit e.V.
- Lloyd’s Register
- Marinesoft GmbH
- MARSIG mbH
Assoziierte Partner
- AIDA Cruises GmbH
- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), WS 23
- Hafen- und Seemannsamt Rostock
- Verband Deutscher Reeder
- World Maritime University
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Gesamtziel des Vorhabens war die Unterstützung einer vollständigen, schnellen und sicheren Evakuierung von Passagierschiffen durch die Entwicklung innovativer Konzepte und technischer Lösungen unter besonderer Berücksichtigung älterer und mobilitätseingeschränkter Personen. Die Konzepte sollen die Sicherheit von Menschen auf Passagierschiffen erhöhen, ohne deren Freiheit und Persönlichkeitsrechte einzuschränken.
Gesamtziele des Verbundesvorhabens
Unter Berücksichtigung psychologischer Erkenntnisse und mit dem Ziel einer hohen Gebrauchstauglichkeit wurden technische Ansätze zum Personen-Tracking, zur Lenkung von Besatzungsmitgliedern und Passagieren, stationäre Anzeigen für die Besatzung, dynamische Fluchtweganzeigen, ein Entscheidungsunterstützungssystem-Modul und die Einrichtung eines Reederei-Lagezentrums entwickelt. Die entwickelten Konzepte und Technologien wurden im Rahmen von Feldtests evaluiert und überarbeitet.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Das Teilprojekt des ISV e.V. konzentrierte sich auf die Bereiche Evakuierungsabläufe und bauliche und technische Unterstützung, insbesondere für in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen (PEM).
In einem umfangreichen Feldversuch mit über 150 beteiligten Personen wurden unterschiedliche Evakuierungskonzepte in Abhängigkeit der Lagerung der Rettungswesten auf den Kabinen bzw. an der Musterstation untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass, je nach Schiffsgröße, baulichen Bedingungen und der Ablauforganisation eine kürzere Gesamtevakuierungszeit zu erwarten ist, wenn die Rettungswesten für die Fahrgäste an der Musterstation ausgegeben werden.
Zur Organisation und den Bedingungen des Transports von PEM in Notfallsituationen wurden Befragungen der Crew durchgeführt. Parallel wurden mobil eingeschränkte Personen zu ihren Unterstützungsbedürfnissen an Bord befragt.
Ergebnisse des Institutes für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V.:
Mit diesem Hintergrund wurden Hilfsmittel direkt an Bord getestet und nach den ermittelten Kriterien bewertet. Zur erleichterten Überwindung von Treppen mit rollenden Hilfsmitteln wurden Prinzipmodelle entwickelt. Die Forschungen haben ergeben, dass ein Rettungsgurt-Tragesitz eine in vielerlei Hinsicht gute Lösung ist, um PEM im Notfall auf dem Weg zum Sammelplatz zu unterstützen. Vielversprechendes Entwicklungspotential ergab auch die Betrachtung der Fahrstühle an Bord von Fahrgastschiffen. Die Möglichkeiten der Ertüchtigung der Fahrstühle zur Einbeziehung als Transporthilfsmittel in Notfalllagen sind an Bord (im Gegensatz zum Land) bisher kaum ausgeschöpft.
Die Forschung zum Ausbildungsstand der Besatzungen als auch in der Lehre zum Umgang mit Fahrgästen mit „special needs“ [PEM] ergab Erweiterungs- und Konkretisierungspotential über den derzeitigen international festgelegten Rahmen (STCW) hinaus.
